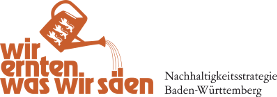Kein Update, kein Kamera-, kein Akku-Tausch
Das ist einfach nur voll ärgerlich. Kaum zwei Jahre alt, schon lässt sich Merles Smartphone nicht mehr updaten. Ihre meist genutzten Apps laufen nicht mehr – Betriebssystem zu alt. Der interne Speicher kann nicht erweitert, der Akku nicht getauscht werden, geschweige denn die Kamera. Ist die Sonne weg, werden die Bilder unscharf. – Kein Wunder, dass allein in Deutschland jährlich mehr als 24 Millionen Smartphones verkauft werden.
Zählt man Router und Festnetztelefone noch dazu, so sind das 250.000 Tonnen Neugeräte. Elektrogeräte allgemein kommen auf 1,7 Millionen Tonnen.
Merle hat Glück. Ihre Mutter hat von ihrer Arbeitgeberin ein neues Handy bekommen. Ihr eigentliches überlässt sie Merle. Die fragt ihre Schwester, wo sie ihr altes Handy hintuen kann. „Papas Schreibtisch, unterste Schublade“, antwortet diese, wie aus der Pistole geschossen, als wäre ein privater Handy-Friedhof das Normalste der Welt. Tatsächlich ruhen dort bereits neun Familien-Handys.
Sie wird stutzig. Viele Fragen schießen ihr in den Kopf. Doch bevor sie im Internet nach Antworten sucht, kommt ihr der zwei Wochen zurückliegende Besuch auf dem Übermorgen Markt in den Sinn. Dort war sie am Stand der Junge Plattform mit Anna ins Gespräch gekommen und hatte von deren nachhaltigen Stadtführungen in Stuttgart erfahren. Kurzerhand greift sie zum Fon und wählt Annas Durchwahl. Die ist direkt dran. Und so erhält sie neben der Anmeldebestätigung einen interessanten Link-Tipp zu ihrem Handy-Friedhof.
Was steckt im Handy eigentlich so drin?
Der Link liefert Merle Antworten: 60 verschiedene Rohstoffe. Davon 30 Metalle wie Platin, Silber und Gold.
Für die Gewinnung der Rohstoffe braucht es große Flächen. Hierzu werden:
- Wälder gerodet
- giftige Stoffe zum Lösen von Metallen aus Gestein eingesetzt, die Flüsse und Meere verschmutzen. Allein in Deutschland benötigen Sony, Apple, Samsung etc. 720 kg Gold pro Jahr – nur für die Herstellung neuer Handys. Dafür bedarf es Unmengen an Zyanid und Quecksilber, die das Ökosystem vergiften.
Was bedeutet das für die Menschen in den Abbauländern?
Viele verlieren ihre Lebensgrundlage, werden krank, müssen Gebiete, die sie seit Generationen bewohnen, verlassen. Gesundheitsschädlich ist zudem die Arbeit in den Mienen. Doppelt schlimm, wenn Kinder unter den Arbeiter*innen sind.
Was geschieht mit ausgedienten Elektrogeräten?
Europäischer Elektroschrott landet oftmals illegal auf Mülldeponien in Afrika. Dort versuchen Menschen, die verbauten Rohstoffe zurückzugewinnen – stark zu Lasten ihrer Gesundheit.
Was kann ich tun?
Das alte Handy möglichst lange nutzen. Und dann darauf achten, dass es fachgerecht recycelt wird. So könne die Rohstoffe zurückgewonnen und wiederverwendet werden.
Beim Kauf eines neuen Handys checken, ob es sich gut reparierten lässt und unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde – z.B. sind recycelte Metalle zum Einsatz gekommen? Oder gleich statt eines neuen, ein gebrauchtes Gerät kaufen.
Wohin mit dem Handy-Friedhof?
Der Tipp von Anna führt Merle auf die Website der Handy-Aktion BaWü. Dort ordert sie eine Sammelbox für Alt-Handys. Diese stellt sie in der Schule auf. Dazu druckt sie Handzettel mit den wichtigsten Fragen und knappen Antworten rund um das Smartphone. Zudem geht sie in die verschiedenen Klassen und hält Kurzvorträge mit dem Titel: Mein persönlicher Handy-Friedhof
Was muss die Politik tun?
Elektrogeräte, wie Smartphones gehen immer schneller kaputt. Zudem bringen die Hersteller ständig neue Modelle auf den Markt, für deren Herstellung viel Energie und wertvolle Ressourcen aufgewendet werden müssen.
Daher ist es dringend an der Zeit, dass Bundesregierung und EU tätig werden und:
- umweltfreundliche Dienstleistungen (reparieren, recyceln, Software Updates bereit stellen) und Produkte (gebrauchte oder nachhaltige Geräte) finanziell fördern.
- Standards zum Ökodesign festzulegen (z.B. robuste und reparaturfreundliche Geräte).
- verbindliche Zielquoten für die Sammlung, Wiederverwendung und Recycling einführen.
Gibt es Handys, die für eine längere Nutzung ausgelegt sind?
Wie ein verbraucherfreundliches Ökodesign umgesetzt werden kann, zeigt das Fairphone 2, das besonders modular und reparierbar aufgebaut ist. Modular bedeutet, dass z.B. Kamera, Akku, Display einfach durch den Nutzer selbst ausgetauscht werden können.
Nachhaltiger Stadtrundgang – alle sind dabei
In Merles Freundeskreis haben alle ständig neue Handys. Da ist kaum eines älter als zwei Jahre. Der Frust darüber sitzt aber bei allen recht tief. Endlose Stunden Rasenmähen in der Nachbarschaft, Zeitungsaustragen morgens um 4 Uhr. Endlose Diskussionen mit Eltern und Großeltern um den Restbetrag. „Das ist doch nicht Ernst. Wieso lässt sich das Display nicht reparieren“, fragen diese zurecht.
Und natürlich sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtige Themen. Merle braucht daher keinerlei Überredungskunst. Alle sind begeistert und dabei, sobald sich Anna in Stuttgart auf den nächsten Stadtrundgang begibt. Folgende Themen im Sinne der Nachhaltigkeit stehen dann auf dem Plan: Textilien, Feinstaub & Mobilität, Lebensmittel, Lichtverschmutzung, Plastikvermeidung, Kosmetik und Elektronik. Besonders gespannt sind sie auf den Besuch bei der Firma AFB, die Elektrogeräte überholt und wieder verkauft.
Weitere Infos
Du willst Deinen eigenen Handy-Friedhof sinnvoll beerdigen? Eine Sammelbox erhältst Du hier.
Dein Wissen zu Nachhaltigkeit bei Smartphones und Co. kannst du mit der Studie der Deutschen Umwelthilfe verfeinern.
Und im Video Kurz erklärt: Mobiltelefone – Schatzkisten mit Geschichte