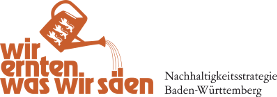Der Respekt vor Starkregen und extremen Wetterereignissen nimmt immer mehr zu, denn sie führen immer häufiger zu überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und Schäden an Infrastruktur. Die Auswirkungen der Klimakrise sind spürbar, und um uns darauf bestmöglich einzustellen, müssen wir unsere Bebauung und die Flächenversiegelung in Städten überdenken. Denn versiegelte Flächen verhindern, dass Regenwasser ausreichend von der Kanalisation aufgenommen oder im Boden versickern kann, wodurch es unkontrolliert abfließt. Die Idee? Eine Schwammstadt.
Was ist eine Schwammstadt?
Das Konzept der Schwammstadt (englisch: Sponge City) setzt auf eine Stadtplanung, die Wasser nicht ableitet, sondern aufnimmt, speichert und langsam wieder abgibt – wie ein Schwamm eben. Ziel ist es, den natürlichen Wasserkreislauf auch im urbanen Raum zu erhalten oder wiederherzustellen.
So funktioniert die Anpassung an den Klimawandel in der Stadt:
- Mehr Grünflächen: Parks, bepflanzte Dächer und Fassaden sorgen nicht nur für Kühlung, sondern speichern auch Regenwasser.
- Wasserfreundliche Böden: Versickerungsfähige Beläge wie Rasengittersteine oder spezielles Straßenpflaster ermöglichen, dass Wasser in den Boden eindringen kann.
- Besseres Management von Regenwasser: Mulden, Entwässerungsgraben (sog. Rigolen), Teiche oder unterirdische Sammelbehälter für Wasser (sog. Zisternen) speichern überschüssiges Wasser und entlasten das Kanalsystem.
- Stadtbäume und urbane Wälder: Sie nehmen Wasser über ihre Wurzeln auf und geben es über die Blätter langsam wieder ab. Das verbessert auch das Klima der Umgebung.
Gleichzeitig steigt mit Stadtgebieten, die so naturnah wie möglich gestaltet sind, auch die Lebens- und Aufenthaltsqualität. Quasi eine Win-Win-Situation!
Beispiele für die Umsetzung des Schwammstadt-Konzepts in Baden-Württemberg:
In Friedrichshafen wurde der Adenauerplatz komplett neu gestaltet. Herzstück ist ein kleiner „Baumhain“ mit 22 robusten Bäumen, die auch bei heißem Wetter gut klarkommen. Denn unter dem Platz steckt moderne Technik: Regenwasser wird in einer speziellen Schicht unter der Erde gespeichert, gefiltert und später wieder an die Bäume abgegeben. So bleibt es kühl, und bei Starkregen läuft das Wasser nicht einfach davon, sondern wird sinnvoll genutzt.

© k1, Landschaftsarchitekten
Der Zollhallenplatz in Freiburg wurde mit einem System aus durchlässigen Pflasterbelägen, Mulden und unterirdischen Rigolen ausgestattet. Regenwasser kann so direkt vor Ort versickern, zwischengespeichert und über Filter- sowie Absetzschächte gereinigt werden, bevor es dem Grundwasser zugeführt wird. Dadurch wird die Kanalisation entlastet.
In Stuttgart wurde 2022 die neu gestaltete Calwer Passage eröffnet. Die 133 Meter lange Fassade ist mit rund 40 großen Bäumen sowie Tausenden Pflanzen begrünt. Auf dem Dach wächst ein kleiner urbaner Mischwald mit Bäumen wie Eichen, Kiefern und Hainbuchen. Ein intelligentes System aus Rankhilfen, Pflanzgefäßen, Substraten und automatischer Bewässerung sorgt also dafür, dass die Begrünung dauerhaft funktioniert. Die Fassade verbessert das Mikroklima, spendet Schatten, filtert Luft und speichert Regenwasser.

© Jonathan Obertreis